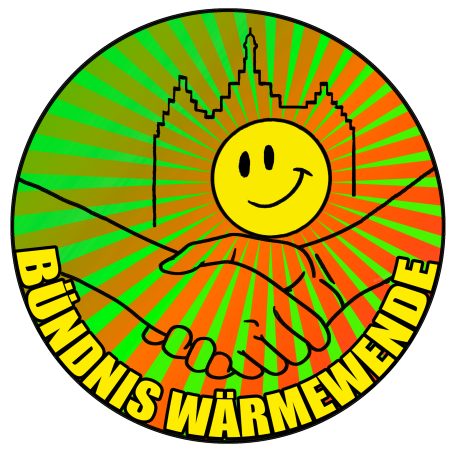Dringende Maßnahmen parallel zur Wärmeplanung
- Abbau von Barrieren bei der Wärmewende: massiver Aufbau städtischer Planungskapazitäten, Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse, Maßnahmen zum Abbau des Fachkräftemangels.
- Erhöhung des Tempos der energetischen Sanierung (vor allem mit Hilfe von ökologischen Baustoffen) auf vier Prozent des Gebäudebestandes pro Jahr.
- Entsprechend dem Ziel, „Klimaneutralität bei der Stadtverwaltung bereits bis 2030 zu erreichen“, kommt dem stadteigenen Gebäude- und Wohnungsbestand (ABG, Nassauische Heimstätte etc.) eine wichtige Vorbildfunktion zu.
- Die Sanierungsgeschwindigkeit der bestehenden Gebäude ist von entscheidender Bedeutung. U.a. sind dafür einfache und kopierbare Sanierungslösungen, Quartierslösungen und größere Projekte erforderlich.
- Die meisten Wohnungen sind privat vermietet [26]. Um Menschen vor Gentrifizierung und steigenden Gaspreisen zu schützen, wird konsequent die Sanierungsoffensive I [27] umgesetzt, die u.a. den Vorschlägen von Mieterbund und BUND folgt [11].
- Die Stadt Frankfurt beauftragt die “Energiekarawane” [28], um Hausbesitzer*innen für eine warmmietenneutrale Sanierung zu aktivieren und die Sanierungsrate in Quartieren bis auf 15% zu steigern.
- Alle Quartiere werden systematisch einbezogen, um insgesamt Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen. Dies kann nur gelingen, wenn die Planung/Umsetzung in einigen Quartieren bereits parallel beginnt. Auch hier müssen ABG und Nassauische Heimstätte Vorbild sein und die Planung/Umsetzung aktiv unterstützen.
- Erhöhung des Fernwärmeausbau-Tempos auf mind. 50 km pro Jahr. (Wien und Linz waren lt. Konzeptstudie dazu bereits vor 25 Jahren in der Lage [8, Konzeptstudie Anhang, S.83].
- Schnellstmögliche Umstellung der Fernwärme auf erneuerbare Ressourcen wie Solarthermie, Geothermie, Abwärme aus Rechenzentren, Industrie und Abwasser, Flusswasser-Großwärmepumpen. Den Bau von Großwärmepumpen mit Verweis auf Strommangel abzulehnen, während sich der Stromverbrauch durch Rechenzentren immens zunimmt, ist nicht nachvollziehbar.
- Umstellung des innerstädtischen Dampf- zu einem Heißwassernetz bis 2030. Nur ein Heißwassernetz kann Geothermie, Großwärmepumpen und Industrie-Abwärme nutzen, während ein Dampfnetz auf Kohle oder Gas auf Brennstoff angewiesen ist.
- Förderung dezentraler Versorgung durch (Groß-)Wärmepumpen und kalte Netze [13].
- Zwischenspeicherung der Energie zur Dekarbonisierung der Spitzenlast
- “Schnelle Eignungsprüfung: Im Rahmen von § 14 WPG sollten Kommunen zeitnah entscheiden, welche Gebiete für Wärmenetze und welche für dezentrales Heizen geeignet sind. In Letzteren sollte eine verkürzte Wärmeplanung Hauseigentümer*innen noch vor Abschluss der gesamten kommunalen Wärmeplanung Planungssicherheit ermöglichen.” [14, S.1].
- “Integrierte Planung: Die Wärmeplanung muss die vorhandenen kommunalen Planungen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungspläne) integrieren. Nur so lassen sich Synergien schaffen und Langfristigkeit garantieren.” [14, S.1].
- “Gesicherte Umsetzung: Die Kommunen müssen schon in der Planungsphase die Umsetzung ihrer kommunalen Wärmeplanung berücksichtigen und vorbereiten. Dazu braucht es verbindliche Beschlüsse und einen klaren, terminierten Fahrplan zur Umsetzung, welcher auch öffentlich kommuniziert wird.” [14, S.1].
Die für die Umsetzung verantwortlichen Verwaltungsstellen sind in den Planungsprozess so einzubeziehen, dass sie den Umsetzungsprozess verantwortlich vorantreiben, damit am Ende nicht ein Plan existiert, für den sich niemand verantwortlich fühlt [29, S.22/23]. Andere Städte sind inzwischen wesentlich weiter als Frankfurt. Hannover hat bspw. die kommunale Wärmeplanung bereits zum Jahresende 2023 vorgelegt [22]. Köln informiert seine Bürger*innen über die Planungen [23] und plant die größte Flußwasser-Wärmepumpe Europas für 50.000 Haushalte [24]. Mannheim plant die Stilllegung des Gasnetzes für 2035.
- Unabhängige und gute Planung: Vorgaben und Rahmensetzung für die Wärmeplanung als ein politischer Prozess müssen von der kommunalen Politik kommen. Es braucht personelle Kapazitäten innerhalb der Kommune, um die Wärmeplanung zu begleiten. Ziehen Kommunen externe Dienstleister (Planungsbüros, Energieunternehmen, Stadtwerke) für die Planung heran, müssen diese qualifiziert und ohne kommerzielle Eigeninteressen an dem Resultat sein [14, S.3].